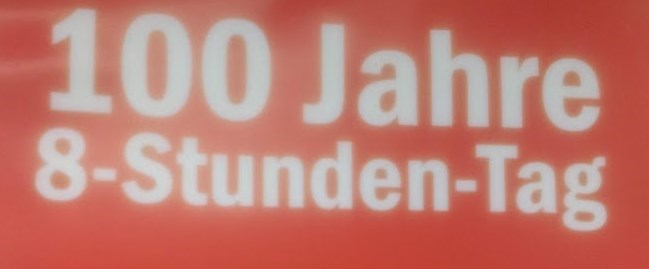100 Jahre 8-Stunden-Tag, Vortrag von Prof. Ingrid Kurz-Scherf bei der Veranstaltung der Attac AG ArbeitFairTeilen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 27. Oktober 2018 in Erfurt:
Im November 1918 wurde auf Beschluss des Rates der Volksbeauftragten eine Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter erlassen. Es war die Geburtsstunde des Achtstundentages. Seit es ihn gibt, ist er umkämpft: auf der einen Seite den Angriffen derer ausgesetzt, die sich die Arbeit anderer Menschen aneignen; auf der anderen geht es darum, die Frage der Arbeitszeit zum Gegenstand gesellschaftlicher Emanzipation zu machen, durch weitere Verkürzung, durch Umverteilung von Arbeit. Ende Oktober stand der Achtstundentag im Mittelpunkt einer Festveranstaltung mit dem Untertitel »Zeit für den nächsten Schritt«. Veranstaltet von der Attac-AG ArbeitFairTeilen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung ergriff dort neben Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow auch Ingrid Kurz-Scherf das Wort. Die Politikwissenschaftlerin war viele Jahre Leiterin des Tarifarchivs beim gewerkschaftsnahen WSI, Abteilungsleiterin für Tarifpolitik beim DGB-Bundesvorstand sowie Staatssekretärin für Arbeits- und Frauenpolitik im Saarland sowie in Brandenburg. Von 2001 bis Mitte 2015 lehrte sie als Professorin für Politische Wissenschaften in Marburg. OXI dokumentiert eine leicht gekürzte Fassung ihrer Rede, in der es um Notwendigkeit und Dialektik einer großen gesellschaftlichen Bewegung geht. Die Festveranstaltung zu 100 Jahre Achtstundentag ist im Internet unter rosalux.de dokumentiert.
Ingrid Kurz-Scherf über 100 Jahre Achtstundentag und umkämpfte kleine Siege der politischen Ökonomie der Arbeit gegenüber der politischen Ökonomie des Kapitals:

»Vielleicht sind wir immer noch viel zu bescheiden«
Ich muss gestehen, dass ich mich mit der Vorbereitung dieser Festansprache sehr schwergetan habe. In der Einladung wurde darum gebeten, dass wir den Achtstundentag als Errungenschaft gebührend feiern und uns gleichzeitig vorbereiten auf die nächste Etappe, also den Sechsstundentag. Mir liegt der sehr am Herzen. Aber wenn man diesen historischen Zusammenhang herstellt, fällt auf, dass der Achtstundentag von einer sehr großen, mächtigen, weltumspannenden Bewegung vorangebracht wurde. In bewundernswerter Ausdauer wurden jahrzehntelang Kämpfe geführt. Und am Ende verhalf diese Bewegung in einer Revolution diesem Kampf zu Gesetzeskraft.
Wenn man sich dagegen den Sechsstundentag anschaut, ist beides nicht der Fall. Es gibt weder die große Bewegung, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, noch gibt es, noch weniger, eine revolutionäre Situation, in der dieser Sechsstundentag als eine Bewegung, als ein Aufbruch in eine neue glänzende Zeit erstrahlen könnte.
Und die Frage ist jetzt: Muss oder kann man hinter diese Feststellung ein »Noch« setzen? Es ist noch nicht so, aber vielleicht wird es so werden? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass, wenn es für alle, die hier sitzen, zwar kein Problem ist, es aber offensichtlich eines ist, diese Tatsache in gesellschaftlichem Maßstab ein großes Problem darstellt?
Deswegen habe ich mich in der Vorbereitung so schwergetan. Man sollte sich die Geschichte des Achtstundentages anschauen, wie der zum Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit werden konnte, und wir müssten daraus lernen für das, was wir jetzt wollen. Wir wissen, dass man es so macht. Und genau daran habe ich mir dann den Kopf sehr zerbrochen. Ich fürchte, das Ergebnis ist nicht so furchtbar epochemachend. Aber immerhin glaube ich, dass man vielleicht eine These starkmachen kann.
Die Geschichte des Achtstundentages zeigt ja, er wurde letztendlich in einer Revolution in Deutschland durchgesetzt. Doch wenn man genau hinschaut, ist er zwar das Produkt einer Revolution gewesen, aber gleichzeitig war er auch ein Instrument zur Eindämmung dieser Revolution. Ich fürchte, diese Ambivalenz lässt sich nicht aus der Welt bringen. Und vielleicht stecken wir immer in diesem Dilemma. Dass wir auf eine revolutionäre Situation angewiesen sind, andererseits diese revolutionäre Situation nicht herstellen können, sondern immer Gefahr laufen, gegen weiterreichende fundamentale Veränderungen und die Bemühungen darum ausgespielt zu werden. Ich denke, die Zurückhaltung, die man in den Gewerkschaften und durchaus auch bei den Linken in Fragen Arbeitszeitverkürzung spüren kann, hat etwas mit diesem Dilemma zu tun. Statt die Lohnarbeit abzuschaffen, wird sie einfach nur zeitlich begrenzt. Die Praxis zeigt, Arbeitszeitverkürzungen bringen nicht nur Segen, sondern für sie wird meistens auch bitter bezahlt.
Und es hat wenig Sinn, sich darüber hinwegzutäuschen, dass sich der Glanz des Achtstundentags aktuell nicht übersetzt in eine Euphorie in Bezug auf den Sechsstundentag. Ich bin da gar nicht festgelegt, wir können auch über eine 28-Stunden-Woche reden. Ich habe sogar gelesen, die Zeit sei reif für eine 15-Stunden-Woche. Vielleicht sind wir immer noch viel zu bescheiden.
Von Thomas Morus im 16. Jahrhundert beginnend sind die großen sozialen Utopien immer mit einer Verkürzung der Arbeitszeit verbunden gewesen. Und da war der Achtstundentag erst einmal ein pragmatisches Zugeständnis. Wenn man sich die großen Namen der im Übrigen sehr feindlichen politischen Strömungen ansieht, John Stuart Mill, Karl Marx oder Keynes, dann sieht man: Die sind sehr unterschiedlicher Meinung, aber in einem Punkt sind sie sich einig. Der Sinn der Entfaltung des technischen Fortschritts ist neben der Reichtumsmehrung für alle die Anreicherung der Zeit, die jedem zur Verfügung steht. Warum ist diese Einigkeit, die so unterschiedliche Strömungen so lange verbunden hat, nicht unbedingt verloren gegangen, aber doch in den Hintergrund getreten?
Es gab immer die große Gegnerschaft zu dem Projekt »kürzere Arbeitszeiten«. Die Arbeitgeber haben 1918 den Achtstundentag nur zugestanden, weil sie die Sozialisierung wichtiger Industrien verhindern wollten. Aber sie haben schon 1923 dafür gesorgt, dass der Achtstundentag durch die Öffnung hin zum Zehnstundentag wieder relativiert wurde. Man kann sogar sagen, dass in gewisser Weise die Novemberrevolution den Aufbruch in eine neue Zeit in Gang gesetzt hat, der eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich stattfand. Auch was die dauerhafte Installierung des Achtstundentages anbelangt.
Es hat immer wieder seitens der Arbeitgeber im Westen der Republik Versuche gegeben, das wieder auszuhebeln und diese Versuche sind in den letzten Jahren sehr schamlos geworden. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Massivität hier gesagt wird, wir wollen keine Begrenzung der Arbeitszeit – die liegt gegenwärtig bei zehn Stunden. Die Arbeitgeber wollen die Menschen länger als zehn Stunden an mehr als fünf Tagen in der Woche arbeiten lassen. Und die wollen auch diese Ruhezeiten von ununterbrochen neun Stunden nicht. Die Schamlosigkeit, mit der man das heute vorträgt, hat eine neue Qualität. Aber das Unbehagen an jeder Art der Reglementierung der Arbeitszeit ist so alt wie der Versuch, eine Regelung der Arbeitszeit in die Gänge zu bringen.
Deshalb hat auch Karl Marx zu dieser Problematik der dilemmatischen Politik der Arbeitszeitverkürzung sehr eindeutig Stellung bezogen. Er hat sie im Erfolgsfall als Sieg der politischen Ökonomie der Arbeit gegenüber der politischen Ökonomie des Kapitals beschrieben. Was eine sehr starke Würdigung einer Politik ist, die zunächst mal die Produktions- und Eigentumsverhältnisse unangetastet lässt. Deshalb stellt sich mir die Frage, ob diese Politik der Arbeitszeitverkürzung wirklich keine Veränderungen in Gang setzen kann. Ob diese Diagnose nicht zu vorsichtig ist. Liegt nicht in einer konsequenten Politik der Arbeitszeitverkürzung, im Beharren auf der Notwendigkeit kürzerer Arbeitszeiten, auf mehr Leben im Leben, liegt in der Arbeit an diesem Projekt nicht auch eine Chance, einen Aufbruch zu befördern, den das Projekt dann aber auch braucht, um wirksam zu werden?
Ich formuliere die These: Dem ist so. Arbeitszeitverkürzung ist – nicht unbedingt so, wie sie in gewerkschaftlichen Kontexten diskutiert wird, also stärker bezogen auf quantitative Beschäftigungseffekte – ein gesellschaftliches Projekt. Das hat die Bedeutung, dass sich die Defensive, in der sozialemanzipatorisches Denken und Handeln offenkundig seit einiger Zeit steckt, auch daraus ergibt, dass wir sehr wohl alle in der Lage sind, eine gute Analyse des Status quo hinsichtlich der darin enthaltenen Risiken und Zumutungen abzuliefern. Was mit Globalisierung, mit ungebremster Deregulierung an Problemen auf die Menschen, die Politik, die Gesellschaft, die Kultur zukommt, diese Einschätzung kann mit breiter Zustimmung rechnen.
Das Neue ist: Es ist eine umfassende Kapitalismuskritik, die wir zu leisten haben und die wir leisten. Um nicht zu sagen: Systemkritik. Und darauf hatte die Linke mal ein Monopol. Hat sie aber nicht mehr. Inzwischen gibt es Kapitalismuskritik, die sich in ihren einzelnen Facetten von linker Kapitalismuskritik kaum unterscheidet. Inzwischen gibt es Systemkritik, die sich, beispielsweise was die Eliten und deren Selbstrekrutierung anbelangt, den linken Diskussionen annähert, sie geradezu abschöpft. Die aber überhaupt keine sozialemanzipatorische Tendenz hat, sondern nach außen aggressiv wird gegen alles Fremde, alles Andere, die ganz stark eine autoritäre Lösung befördert, in kultureller Hinsicht alles, was mit Emanzipation, Öffnung zu tun hat, aggressiv zurückweist. Und der Humus, aus dem sich das speist, ist, dass diese Kritik partiell durchaus berechtigt ist. Und wo wir mehr oder minder versagen, das ist dabei, den falschen Kritikern eine Kritik entgegenzuhalten, die die reale Möglichkeit, dass es anders sein könnte, wirklich glaubhaft belegt. Was wir können, da nehme ich mich nicht aus: Wir können Forderungen aufstellen. Bürgerversicherung, Arbeitszeitverkürzung, Grundsicherung für Kinder, manche sagen generelle Grundsicherung. Man hat die Systemkritik und dagegen das, was man anders haben will. Aber man kann in der Realität, in der wir leben, nicht mehr angeben, was an diese Forderungen anknüpfen kann.
Das ist unmarxistisch. Das kann eigentlich, wenn denn die Marx’sche Kritik richtig gewesen wäre, nicht stimmen. Weil wir von Marx gelernt haben, dass der Kapitalismus die Möglichkeit seiner Überwindung selbst hervorbringt. Das, was an ausbeuterischen, ökologisch unverträglichen Entwicklungen vom Status quo ausgeht, wird in der Entwicklungsdynamik selbst wieder in Frage gestellt. Deshalb kann eine Politik, die sich sozial emanzipatorisch mit der Welt auseinandersetzt, nicht nur Forderungen artikulieren, sondern sie kann immer auch sagen, welche realen Möglichkeiten es gibt, diese Forderungen umzusetzen. Und meine These ist. Das können wir zurzeit nicht besonders gut.
Doch genau da liegt das Potenzial von Arbeitszeitpolitik. Denn reale Arbeitszeitentwicklung ist tatsächliche hochgradig widersprüchlich. Wir haben Angriffe auf den Achtstundentag, eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeitssysteme, die Ausweitung von ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen, Entwicklungen, die quasi, statt mehr Leben ins Leben zu bringen, Menschen immer mehr unter die Fuchtel der Arbeit geraten lassen, weil sie ständig verfügbar sind. Das sind reale Gegebenheiten. Wir haben einen Verlust der Gestaltungsmacht gegenüber der Realität der betrieblichen Arbeitszeiten seitens der Gewerkschaften und des Gesetzgebers. Wir haben gleichzeitig eine Entwicklung, die eine säkulare Tendenz weiterbefördert, an die sich Politik schon immer hat anschließen können. Denn weiterhin sinkt die im Durchschnitt pro Erwerbstätigem geleistete Arbeitszeit. Sie sinkt und sinkt. Und da kann Politik veranstalten, was sie will. Es steigt nicht das Volumen bezahlter Arbeit, es sinkt. Wir haben einen Bruch. Bis zum großen Kampf um die 35-Stunden-Woche in den 80er Jahren im Westen hatten wir den gleichen Prozess. Den Rückgang der durchschnittlichen geleisteten Arbeitszeit. Das war aber kontrolliert von tarifvertraglichen gesetzlichen Eingriffen in die Gestaltung der Arbeitszeit. Seit Anfang der 1990er Jahre hat der Prozess die gleiche Konsequenz, aber er vollzieht sich nicht mehr auf der Grundlage von Tarifverträgen, sondern durch die Ausweitung von Minijobs, Teilzeitarbeit, diskontinuierlicher Erwerbstätigkeit, weil Menschen die Normalarbeitszeit tatsächlich nicht wollen, wenn wir nur an die Frauen im Westen denken: Da war Teilzeit teils erzwungen, teils wollten sie sich den Normalarbeitszeiten nicht unterwerfen.
Es gibt diese Sympathie für kürzere Arbeitszeiten. Falsch ist zu sagen: Frauen haben eine Präferenz für Teilzeit. Das stimmt so nicht, denn Frauen haben keine Präferenz für Lohnverzicht, sondern für kürzere Arbeitszeiten. Und zwangsweise wird das in Lohnverzicht umgelenkt. Normalarbeitszeit orientiert sich nicht an den Interessen der Frauen, stattdessen stark an männlichen Modellen.
Aber das alles findet statt. Eine Restrukturierung der Arbeitszeiten, die uns auf die Defizite und Versäumnisse der Arbeitszeitpolitik verweist. Wir haben nicht nur die Meinung: Es wäre doch schön, wenn die Menschen weniger arbeiten müssten. Wir haben eine reale Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten und diese Entwicklung erfordert ein politisches Handeln, anders, als es in den letzten Jahrzehnten dominant war. Dazu braucht es einer wirklich spezifisch deutschen Problemdiagnose, die aus der Vereinigung resultiert.
Wir hatten in den 1980er Jahren den großen Streik für die 35-Stunden-Woche. Das war, als wir Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA hatten und Helmut Kohl die »geistig-moralische Wende« ankündigte. In dieser Zeit gingen die Gewerkschaften – nicht alle – in eine Auseinandersetzung um die Dauer der Wochenarbeitszeit. Und obwohl der Gesichtspunkt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sehr stark war – da stand die Qualität der Arbeitsplätze meist nicht so im Vordergrund –, war die ganze Kampagne getragen von einer gesellschaftlichen Mobilisierung für eine solidarische Gesellschaft. Und mit dieser gesellschaftlichen Mobilisierung haben es die Gewerkschaften geschafft, diese geistig-moralische Wende, die Kohl wollte, zumindest abzubremsen.
Ende der 1980er Jahre war das Ende der Ära Kohl eigentlich sicher. Der Kandidat der SPD hieß Oskar Lafontaine. Und es war klar, dass er die Wahl gewinnen würde und die SPD war gewillt, eine Wende in eine andere Moderne herbeizuführen, raus aus einer verengten, verkürzten Arbeitsgesellschaft, die alles nur auf Arbeit, Arbeit fokussiert. Sie hat sich in einen Programmprozess begeben, der nannte sich F90. Und die Arbeitszeitkomponente war der Sechsstundentag – offizielles Programm der für die Bundestagswahlen antretenden Sozialdemokratie. Auch die sozialdemokratischen Frauen hatten diese klare Ansage Richtung Sechsstundentag.
Bedauerlicherweise war Franz Steinkühler, der damalige Vorsitzende der IG Metall davon nicht so begeistert. Und es gab durchaus Tendenzen, diese Arbeitszeitfrage in einen veritablen Geschlechterkonflikt umzuwandeln. Aber der eine oder andere Kollege stand an der Seite der Frauen im Kampf um den Sechsstundentag. Und der Kampf war organischer Teil eines gesellschaftlichen Projekts, das sich vom Status quo verabschieden wollte.
Es gab damals die sehr schöne Feststellung: Die Zukunft hat aufgehört, die Verlängerung der Tendenz der Vergangenheit zu sein. Oskar Negt hat ein Buchkapitel überschrieben mit »Nur noch Utopien sind realistisch«, das habe ich ihm später für ein ganzes Buch geklaut, das ich gemacht habe. Der Tenor war: Wenn wir den Karren gegen die Wand fahren, dann weil wir weitermachen wie bisher. Es kommt der Bankrott der Industriemoderne auf uns zu. Da müssen wir raus.
So. Und dann kam die Deutsche Einheit. Schluss war. Ich verbinde damit zwei Schlüsselerlebnisse. Ich war an dem Tag in New York. In der U-Bahn las ich die Überschrift: »We won!«. So sah man das in den USA. Das war ihr Triumph, so haben die das gesehen. Das andere Erlebnis: Ich sitze irgendwann in Berlin vor der Glotze, da wird der Bildschirm blau. Bleibt blau. Dann kommt: »Zukunft der Arbeit. Deutsche Bank«.
Es gibt Situationen, in denen man nicht so gerne Recht hat. Anfang 1990er hatte ich mit einem einstigen DDR-Institut zu tun, das einen Sozialbericht erstellte. Und ich habe einen Artikel für die geschrieben, der hatte die Überschrift: »Die blockierte Transformation«. Die These war: Mit dieser Haltung, im Osten muss sich alles ändern und im Westen kann alles bleiben, wie es ist, ist alles, was wir im Vorfeld diskutiert und begonnen haben, verhindert und verwischt, und das verhindert eine Transformation. Und ich habe damals gesagt. »Das werdet ihr noch mal teuer bezahlen.« Ich bin nicht froh, dass ich Recht behalten habe.
Ich glaube, dass es die Möglichkeit und die Notwendigkeit gibt, noch einmal neu an eine konzertierte, doppelseitige Transformation in Deutschland anzuknüpfen, und das in neue Kontexte zu überführen. Die alten Debatten in die inzwischen fundamental geänderten Bedingungen übersetzen und in einen Transformationsprozess führen, für den viele Menschen etwas übrig haben.
Wir können nicht davon ausgehen, den alten Klassenkampf reaktivieren zu können. Wir sind mehr, aber wir sind auch sehr verschieden. Was wir versuchen müssen, ist nicht eine Mehrheit der Ähnlichen, sondern genau eine Mehrheit der Verschiedenen oder eine Mehrheit der Minderheiten, die einander in wechselseitiger Akzeptanz und Solidarität verpflichtet sind. Die sich nicht ausgrenzen und diffamieren, sondern stützen und schätzen.
Dann kommt man aus dieser Situation raus, furchtbar über den Status quo zu erschrecken. Der Kontext muss neu konstruiert und darf nicht nur negativ, sondern muss auch positiv bestimmt werden. Man kann über Arbeitszeitpolitik die Welt nicht komplett verändern. Aber man kann aus dem Duktus der bloßen Verteidigung der Errungenschaften der Vergangenheit entkommen und einen Aufbruch in die Zukunft formulieren.
Neulich habe ich ein Grafitto gesehen: Eine Mutter sagt zu ihrem Sohn: »Kevin, es könnte alles noch viel schlimmer sein.« »Ja«, antwortet Kevin. »Aber es könnte auch alles viel besser sein.« Und das muss die Linke zum Programm erheben.
Veröffentlicht in der Zeitung OXI 1/2019: https://oxiblog.de/aktuelle-ausgabe/
Wer den Vortrag auch sehen und hören möchte: